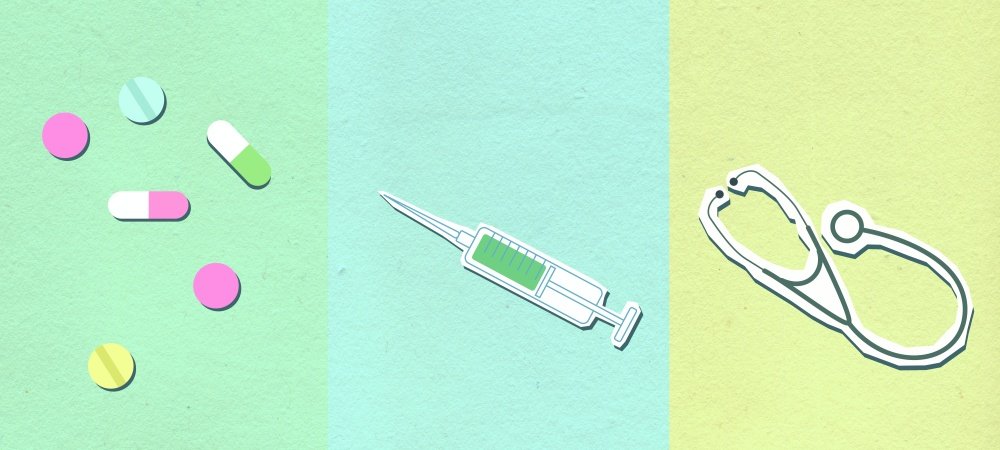Schmerzen und Beschwerden von Frauen werden von der Medizin oft kleingeredet. Das hätte Elinor Cleghorn fast das Leben gekostet. In EMOTION erklärt die Kulturhistorikerin, was schiefläuft und was sich ändern muss.
EMOTION: Sie haben herausgefunden, dass Frauenbeschwerden in der Medizin kleingeredet, übersehen, fehldiagnostiziert werden und das seit Jahrhunderten. Wie sind Sie darauf gestoßen?
Elinor Cleghorn: Ich arbeite über feministische Kulturgeschichte und bin darin geübt, auf übersehene Frauen zu achten. Und dann wurde bei mir eine Autoimmunerkrankung diagnostiziert, die nur entdeckt wurde, weil mein ungeborener Sohn Herzprobleme hatte. Die Ärzte waren total auf mein Baby fokussiert. Dass auch meine Gesundheit betroffen sein könnte, war kein Thema. Als mein Sohn neun Wochen alt war, ging es auf einmal mir sehr schlecht, ich hatte ebenfalls Herzprobleme. Man brauchte zehn ganze Tage, um zu erkennen, dass das, was mit meinem Sohn passiert war, nun mich betraf. Danach habe ich mich gefragt, wieso wurde ich so viele Jahre fehldiagnostiziert – und warum war ich die Untersuchungen erst wert, als ich ein Kind im Bauch trug? Mir wurde klar, es gibt auch heute noch Fehleinschätzungen, diagnostische Verzögerungen und Vorurteile, die unser Leben gefährden.
Sie haben auch zurück ins 18. und 19. Jahrhundert geguckt.
Ja, da gibt es Fallgeschichten über Frauen, die dieselbe Krankheit hatten wie ich, Lupus, und als "emotional instabil" abqualifiziert wurden, als "empfindlich" oder "fragil", was den Ärzten eine Art Recht gab, über sie zu verfügen. Die vorherrschende Idee war: Ihre Fortpflanzungsorgane machen Frauen verrückt.
Es gibt so viele geradezu sadistische Gynäkologen in Ihrem Buch, dass man sich fragt, ob es denen vor allem darum ging, über Frauen zu herrschen.
Lange waren nur Männer Chirurgen. Erst seit Frauen in dieses Monopol eingebrochen sind, sehen wir einen mitfühlenden Ansatz, etwa bei gynäkologischen Krebserkrankungen. Davor wurde rein chirurgisch behandelt: Gebärmutter, Eierstöcke raus. Es waren Ärztinnen, die sagten: Frauen wollen ihre Körper erhalten, und das geht! Während Männer mit dem Skalpell dachten, dachten Frauen zuerst an die Menschlichkeit ihrer Patientinnen und was ein Eingriff für ihr Leben bedeutet. Die männlich geprägte Geschichte der Gynäkologie und Geburtshilfe ist eine Geschichte der Gewalt und wirkt sich bis heute auf uns alle aus.
Lies auch:
- Gender Pain Gap: Frauen behandeln Schmerz mit Selfcare statt ärztlicher Hilfe
- Gendermedizin: Warum Frauen eine andere Behandlung brauchen
- Endometriose und Schwangerschaft – wie kann das klappen?
Sie sprechen den "Gender Pain Gap" an, was steckt dahinter?
Frauen wird statistisch gesehen seltener geglaubt, wenn sie über ihre Schmerzen sprechen. Statt Schmerzmittel bekommen sie häufiger Beruhigungsmittel und Antidepressiva verschrieben. Sie werden seltener zu Zusatzuntersuchungen überwiesen. Das reicht bis in die Forschung, bis zu dem, was wir klinisch über Frauenkörper wissen, etwa dass sie auf bestimmte Substanzen anders reagieren. Historisch gab es zu wenig Forschung zu Frauen, das ist noch ein Gap: ein Wissens-Gap. Diese Lücke ist durch antiquierte sexistische Vorurteile entstanden – die sind medizinischer Natur, aber in unserem patriarchalen System auch sozial und kulturell. Unsere Krankheiten hatten niemals Priorität in der Medizin, so wird Endometriose erst jetzt nach und nach verstanden und erforscht.
Ich kenne von mir selbst, dass ich sage: Ach, das ist nichts, das hältst du aus. Wie kann ich erkennen, wann ich doch medizinische Hilfe brauche?
Das ist sehr schwer. Wir wurden darauf konditioniert, unseren Schmerz für normal zu halten, ihn auf Menstruation, Hormone zurückzuführen, Prozesse im weiblichen Körper. Wir wurden und werden dazu sozialisiert, Schmerz nicht wichtig zu nehmen. Es gibt ein Erbe der Scham, sich für den eigenen Körper zu schämen, über ihn zu schweigen, denn wenn wir reden, wenn wir zu einem Arzt gehen, fürchten wir, als hysterisch, überängstlich oder gestresst abgestempelt zu werden. Zugleich fürchten wir, dass wir Eingriffen Vorschub leisten könnten, die wir nicht verstehen. Da sind wir sehr verletzlich. Ich glaube, dass dieses historische Erbe uns belastet: mit Misstrauen. Neulich sprach ich mit einem sehr guten Arzt, der in einem Institut für Frauengesundheit arbeitet. Er erzählte, dass ihm noch in den 80ern in seiner Ausbildung gesagt wurde: Wenn du bei einer Frau nicht sofort erkennen kannst, was es ist, dann ist sie hysterisch. Die Vorurteile verhindern Objektivität.
Ich bin es so gewohnt, stark zu sein, dass es mir schwerfällt, mich als "leidende Frau" zu sehen.
Oh, das verstehe ich! Ich bin 42 und mit diesem Hype "Wir können alles, was Männer können, zeig keine Verletzlichkeit" aufgewachsen. Was wir neu lernen müssen: Über deinen Körper zu reden, ist keine Schwäche, es ist sogar eine Stärke. Wir sind über Jahrhunderte so konditioniert worden, das als Schwäche zu empfinden. Aber jetzt gibt es eine neue Generation von jungen Frauen, auch prominente, die über ihre chronischen Erkrankungen und körperlichen Bedürfnisse reden, auf Social Media und anderswo, und so zeigen: Was uns wirklich schwächt, ist das Schweigen. Sie zeigen auch, es ist empowernd, dass ich trotz einer Erkrankung geistig und gedanklich stark sein kann. Dass ich ehrlich sagen darf, wie es ist, in meinem Körper zu leben. Das ist ein ganz neues Konzept von "Selfhood". Es kann eine Quelle von Stärke sein, von Gemeinschaft. Es ist ein Weg, das Narrativ vom Kranksein zu verändern und uns von der Scham für unsere Körper zu befreien.
Der Begriff "emotional" wird heute oft so gebraucht wie früher "hysterisch".
Es gibt eine bahnbrechende Studie von 2001 namens "The Girl Who Cried Pain", die zeigte, dass Frauen dazu neigen, ihren Schmerz zu sozialisieren, also eine ganze Geschichte um ihn herum erzählen, weil Schmerz Folgen hat, um die sich Frauen kümmern müssen. Sie sagen etwa: "Dieser Schmerz ist so stark, dass ich es nicht schaffe, die Kinder für die Schule fertig zu machen, ich weiß nicht, wie ich alles bewältigen soll." Männer dagegen sagen: "Es tut weh. Hier. Seit zwei Tagen." Aber bringen Frauen ihren Partner zum Arzt mit, wird ihnen auf einmal geglaubt. Wir haben sozial und kulturell gelernt: Die Anwesenheit eines Mannes bedeutet Autorität. Frauen werden dagegen als unglaubwürdig, sogar verdächtig gesehen. Selbst Ärzte oder Ärztinnen, die sicher sind, davon frei zu sein, haben diesen "unconscious bias", der nahelegt: Frauen sind so emotional, sie sind durch ihre Gefühle verwirrt.
Müssen wir unseren Schmerz deutlicher zum Ausdruck bringen?
Es liegt nicht daran, wie Frauen ihren Schmerz oder ihren Körper beschreiben, es ist ein Gender Bias. Das bedeutet: Wir können nicht allein verändern, wie unser Schmerz gesehen wird. Bei Tests, in denen Videos von Männern und Frauen gezeigt wurden, die ihren Schmerz gleich beschrieben, wurden die Frauen überwiegend mit "braucht keine Schmerzmittel" bewertet. Es stimmt aber auch, dass unsere Symptome vielleicht diffuser sind. Für mich war es als junge Frau sehr schwierig, meine Symptome zu beschreiben, von denen ich heute weiß, dass sie Lupus-Symptome waren. Ich hatte Gelenkschmerzen, die wochenlang sehr schlimm waren und dann weg. Es kam mir seltsam vor, und ich glaube, viele Frauen kennen das, vor allem bei Schmerzen und Erschöpfung, den beiden Symptomen, die am häufigsten ignoriert werden. Dabei sind es typische Anfangssymptome vieler Krankheiten, die Frauen betreffen.

Wie lässt sich das ändern?
Wir brauchen ein tiefergehendes Verständnis und bessere Diagnostik. Wenn eine Frau sagt, ich bin die ganze Zeit erschöpft, nehmt das als Hinweis, dass irgendetwas in ihrem Körper vor sich geht, dass sie Untersuchungen braucht. Es ist, als ob die Medizin nicht dafür gemacht ist, unsere Sprache zu verstehen, unsere körperlichen Wahrnehmungen. Da muss sich die Medizin ändern – dass wir männlicher, aggressiver, direkter werden müssen, kann kein Weg sein.
Viele Frauen sind dauererschöpft, hoffen aber, ihre Belastung wird wieder nachlassen. Dabei ignorieren sie vielleicht Warnhinweise ihres Körpers?
Es wird gerade viel von Selbstfürsorge geredet. Das ist eine gute Idee, wenn man sie als Selbstkenntnis oder Selbstfreundlichkeit versteht: Unsere Gefühle sind real, sie sind es wert, beachtet zu werden. Aber das Wort macht mich misstrauisch. Nicht jede Frau hat das Selbstvertrauen, hinzugehen, und von einer autoritären Figur wie dem Arzt eine Behandlung zu fordern. Was wir brauchen, ist ein System, das uns anders anspricht und in das wir Vertrauen haben können. Das freundlicher zu uns ist, unsere Körper und unser Wissen darüber respektiert. Viele glauben, besonders, wenn sie Kinder geboren haben, unser Körper sei für Schmerzen gemacht, was eine weitere falsche Annahme ist.
Autoimmunerkrankungen wie Ihr Lupus oder auch rheumatoide Arthritis, Hashimoto oder Multiple Sklerose betreffen stärker Frauen. Weiß man, warum?
Autoimmunerkrankungen sind weltweit auf dem Vormarsch. 80 Prozent der Betroffenen sind Frauen, doch wir wissen noch nicht, warum. Es dauert lange, bis Therapien gefunden werden. Deshalb ist es so wichtig, dass das Mindset sich ändert. Die Diagnostik ist schwierig, dafür braucht man Spezialist:innen, denn diese Krankheiten tarnen sich und entwickeln sich oft in Übergangsphasen wie Pubertät, Schwangerschaft, Menopause. Das gehört in die Ausbildung! Wir brauchen Richtlinien, wie man damit umgeht, wenn jemand solche Symptome zeigt, die oft diffus sind, die kommen und gehen, die vielleicht von Ernährung, Wetter, Licht oder sonst was beeinflusst werden. Es dauert im Schnitt vier bis sechs Jahre, bis Lupus diagnostiziert wird. Doch als ich schwanger war und mein Sohn diese Herzprobleme hatte, wurde ein Bluttest gemacht und am nächsten Tag wusste ich, dass ich diese beiden Antikörper habe. So einfach ist das eigentlich.
Dieser Artikel erschien zuerst in der EMOTION 3/23.
Mehr Themen: