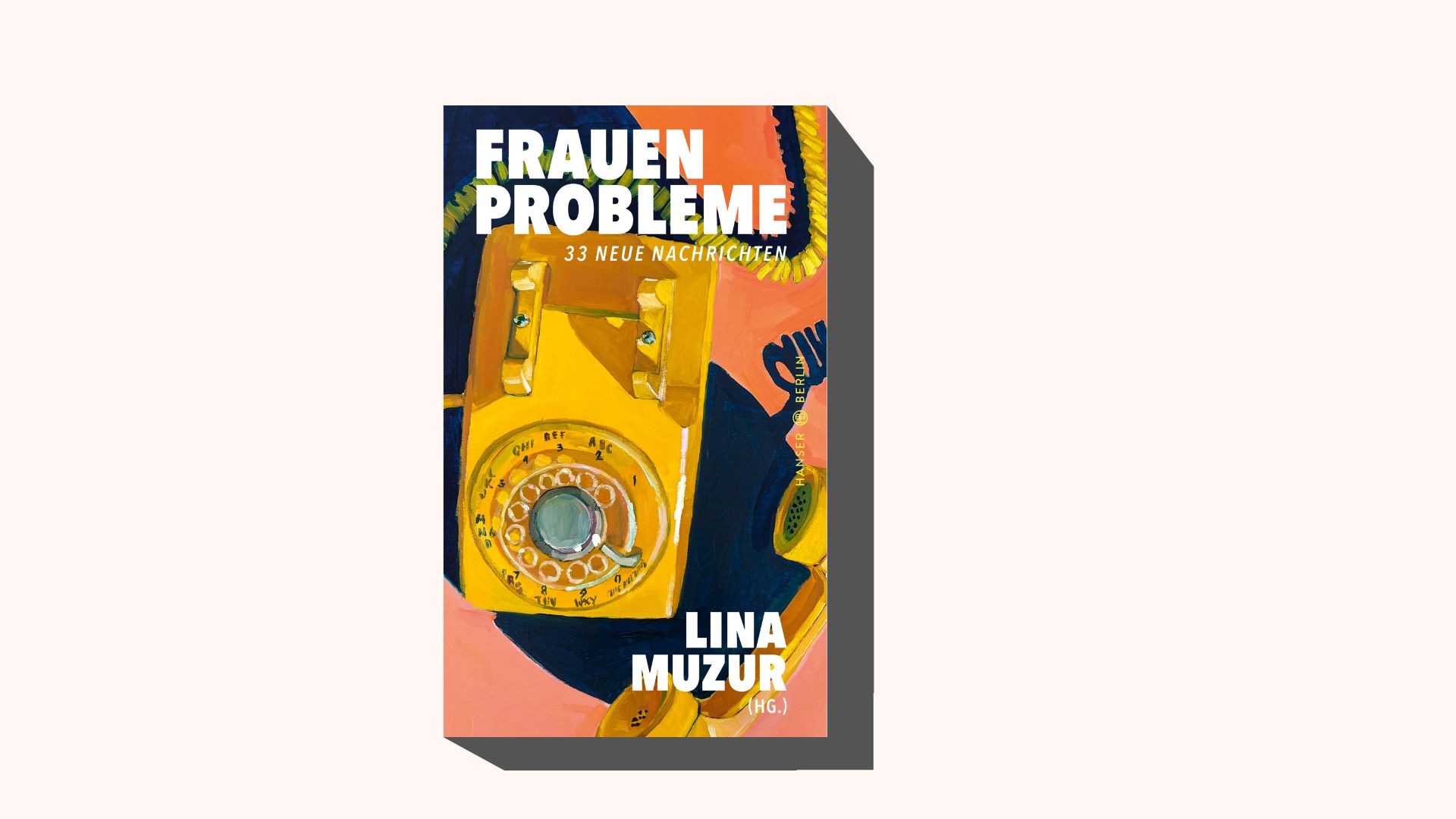Kristina Lunz über Sichtbarkeit
Wie Frauen zum Schweigen gebracht werden – und was dagegen hilft
Fast jede Frau, die im Internet den Mund aufmacht, hat schon Hass erlebt: sexistische Beschimpfungen, Abwertung, Gewaltandrohungen – ausgeübt von Männern, die wollen, dass wir schweigen. Wie können wir uns wehren?
Montag, 8. September 2025
Lesezeit ca. 9 Minuten
Foto: Stevy Hochkeppel
Das „Silencing“ von Frauen, ihre gezielte aggressive Verdrängung aus dem öffentlichen Diskurs, nimmt drastisch zu, wie etwa die aktuelle Pilotstudie „Mapping the GerManosphere“ an der FU Berlin zeigt, die massive frauenfeindliche Strukturen im Netz beschreibt. Und dass dadurch immer mehr weibliche (und diverse) Stimmen aus der Öffentlichkeit verschwinden. Eine dieser Personen ist Kristina Lunz, Gründerin des „Centre for Feminist Foreign Policy“, das auch Ex-Außenministerin Annalena Baerbock beraten hat – und das sie wegen andauernder massiver Attacken und Verleumdungen aus dem Netz gerade geschlossen hat. „Die Schlinge um die Zivilgesellschaft – besonders um die feministische – zieht sich immer enger“, schrieb sie zur Begründung. Und: „Der globale Schwenk ins Autoritäre und Rechtsextreme stellt aktuell die größte Gefahr für feministische und zivilgesellschaftliche Arbeit dar.“
Frau Lunz, warum ist weibliche Sichtbarkeit wichtig?
Wenn Frauen sichtbarer würden, hätten wir mehr Perspektiven, mehr Ideen, mehr Expertise, mehr Bedürfnisse, mehr Vielfalt abgebildet. Und damit ein größeres Portfolio, aus dem wir schöpfen können, um am Ende die Gesellschaft so zu gestalten, wie sie besser wäre, wie wir sie wollen, wie sie gerechter wäre. Es würden wirklich alle gewinnen, wenn Frauen viel sichtbarer wären. Wenn endlich damit aufgehört würde, dass Frauen zurückgedrängt werden, dass sie in Geschichtsbüchern nicht erwähnt werden, dass ihre Erfolge niedergemacht werden. Das ist eine der Hauptsäulen des Patriarchats und ergibt da auch Sinn, weil Patriarchat ja die ungerechtfertigte Vormachtstellung von Männern in Staat, Medien, Familien bedeutet. Es ist verrückt, in welchen Situationen es bestimmte Personen noch schaffen, Frauen abzuwerten.
Denken Sie an ein bestimmtes Beispiel?
Neulich sollte ich eine Keynote halten. Da meinte der Moderator zu mir: „Frau Lunz, Sie haben ja so einen langen CV und schon so viel gemacht. Ich habe gesehen, Sie haben auch zwei Masterabschlüsse aus London und Oxford.“ Ich sagte: „Genau, das waren einjährige Master, die ich gemacht habe.“ Da kam von ihm: „Ah, und ich fragte mich schon, wann die Frau endlich mal zu Potte kommen möchte.“
Da muss man schon sehr tough sein, um sich nicht verunsichern zu lassen.
Wir wissen aus empirischer Forschung: Wenn eine Professorin und ein Professor genau dieselbe Lesung halten mit exakt denselben Inhalten, wird der Mann deutlich besser bewertet als die Frau. Und genauso ist es, wenn Frauen in die Sichtbarkeit gehen und sich öffentlich positionieren, ihre Haltung, ihre Werte teilen. Frauen bekommen viel, viel negativere Reaktionen ab. Anfang des Jahres hat beispielsweise HateAid gemeinsam mit der TU München eine ganz wichtige Studie herausgebracht, die heißt „Angegriffen und alleingelassen“ und zeigt, dass Frauen disproportional häufig Online-Gewalt erleben, wie auch andere, meistens sexualisierte, Gewalt.
Gibt es bestimmte Gruppen oder Verhaltensweisen, die Frauen daran hindern, sich sichtbar zu machen?
Ja, die gibt es. Zum einen haben wir alle Misogynie internalisiert, wir sind alle in einer misogynen, also frauenfeindlichen, sexistischen Gesellschaft sozialisiert, und damit haben auch wir Frauen das ganz tief drin. Und wenn wir uns nicht – über Jahre – Mühe geben, das zu verlernen, dann ist unser Affekt oder unsere Reaktion auf einen Reiz erst mal, die Frau blöder zu finden als den Mann. Man muss wirklich in sich selbst gegen diese internalisierte Misogynie vorgehen, die überall in der Gesellschaft stattfindet und dazu führt, dass so viel schneller ein blöder Kommentar einer Frau hinterhergerufen oder -geschrieben wird als einem Mann. Es ist ein Kontinuum der Gewalt gegen Frauen – sexuelle Belästigung, Gewalt im Internet, Missbrauch, Femizide, das hängt alles zusammen.
„Silencing“, Frauen zum Schweigen bringen, wird auch aktiv betrieben.
Ja, es gibt zunehmend koordinierte Aktionen von Männern, die sich in der Manosphere oder im Darknet organisieren und Attacken gegen Frauen initiieren. Ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung: Kurz nach den Übergriffen der Silvesternacht 2016 in Köln, habe ich mit anderen Frauen die Kampagne „Gegen sexuelle Gewalt und Rassismus. Immer. Überall. #ausnahmslos“ gestartet. Die wurde richtig groß, trendete in den Sozialen Medien, Nummer 1 auf Twitter. Kurz darauf hat, das ergab später eine Buzzfeed-Recherche, eine Gruppe von Frauenhassern sich über das Darknet organisiert, unseren Hashtag gekapert und überall darunter Bilder gepostet, auf denen Frauen Gewalt angetan wird. Sol- ches Vorgehen gegen Frauen, die sich in der Öffentlichkeit positionieren, ist zunehmend orchestriert.
Wie im aktuellen Fall der Verfassungsrechtlerin Frauke Brosius-Gersdorf ...
Anfang Juli wurde eine gezielte Hasskampagne gegen sie entfesselt. Über Wochen war sie massiver digitaler Gewalt ausgesetzt. Das war kein Shitstorm, keine spontane digitale Empörungswelle, sondern ein koordinierter Angriff. Betroffene solcher Hetzkampagnen erleben ein Gefühl völliger Isolation und Machtlosigkeit. Das Urteil scheint längst gefällt, die öffentliche Exekution folgt durch massenhafte Diffamierungen, Drohungen und soziale Ächtung. Diese Dynamiken sind keine Zufälle – sie folgen den Mechanismen der Aufmerksamkeitsökonomie. Je radikaler die Anschuldigungen, desto größer die Reichweite. Hinzukommt der Faktor Geschlecht: Misogynie ist kein Randphänomen, sondern tief in unserer Gesellschaft verankert. Die Bereitschaft, Frauen zu hassen, die sichtbar, klug und engagiert sind, ist ein tragender Pfeiler patriarchaler Machtstrukturen. Die Angriffe auf Frauke Brosius-Gersdorf richten sich nicht nur gegen sie. Sie sind eine Warnung an alle Frauen, die sich öffentlich äußern: Du könntest die Nächste sein.
Für die, die den Begriff noch nicht kennen: Was ist die Manosphere?
Die Manosphere ist ein immer größer werdender digitaler Bereich, in dem Männer sich zusammenschließen und ihrer Verachtung gegenüber Frauen sehr starken Ausdruck verleihen. Wichtige Anführer oder Ideengeber sind Andrew Tate oder auch der Rechtsextreme Nick Fuentes. Es gibt da etwa die Incel-Culture, die „Involuntary celibates“, Männer, die angeblich keine Frauen abbekommen und deshalb unglaublichen Hass auf sie haben und ihnen die Schuld für alles geben. Die Netflix-Serie „Adolescence“ hat uns vor Kurzem vor Augen geführt, wie extrem diese Radikalisierung sein kann und wie weit sie greift – bis in die Kinderzimmer von kleinen Jungs. Es findet zunehmend eine Normalisierung dieses Gedankenguts statt, vor allem auch, seit auf höchster politischer Ebene solche Frauenverächter in Machtpositionen sind. Donald Trump ist da ein Paradebeispiel.
Stimmt es, dass diese Männer oft mit der rechten Szene verknüpft sind?
Ja, ganz eng. Antifeminismus und Rechtsextremismus gehen Hand in Hand. Diese Verbindung gab es schon unter Hitler und den Nazis, das Kleinhalten und die Reduzierung von Frauen auf ihre Gebärfähigkeit, den Erhalt der Nation als ihre Hauptaufgabe. Das ist zentrales Narrativ der Manosphere darüber, was man von Frauen erwarten müsse. Darauf zahlen auch rechte Verschwörungstheorien wie der sogenannte „große Austausch“ ein, wo erzählt wird, dass angeblich Immigrant*innen, die nach Deutschland kommen, die weiße Bevölkerung mittels ihrer höheren Geburtenrate ersetzen würden. Und zusätzlich seien eben die Frauen schuld, die wegen zu lockerer Abtreibungsgesetze Kinder abtreiben, weshalb gegen sie vorgegangen werden müsse, weil sie sich so gegen die weiße Rasse stellten.
Ist es dann nicht furchtbar gefährlich, als Frau sichtbar zu sein?
Ja, ist es – und ich hasse es, das sagen zu müssen. Ich bin seit zehn Jahren mit feministischen Themen in der Öffentlichkeit. Ich habe 2014 angefangen mit einer Kampagne gegen den Sexismus in der Bild-Zeitung, worauf ich zum ersten Mal in meinem Leben wirklich schlimmste Formen von Online-Gewalt erlebte: Vergewaltigungsandrohungen, bildliche Beschreibungen von sexuellem Missbrauch, auch Drohungen gegen meine Familie, was fast dazu geführt hätte, dass ich nicht weitergemacht hätte.
Was hat Ihnen geholfen?
Die Verbindung mit anderen Frauen, die Ähnliches erlebt hatten, hat mir klar gemacht, dass es nicht um mich als Person geht, sondern darum, wie ich mich positioniere. In all dieser Zeit habe ich immer wieder darauf hingewiesen, wie Frauen zum Schweigen gebracht werden, es ist sehr gut durch Zahlen und Studien belegt. Ich habe aber jetzt das Gefühl, dass es sich zuspitzt: Ich nehme die Sozialen Medien immer stärker als polarisierend wahr. In der aktuellen Gesamtlage, die sich auch ergibt aus der Zunahme von Kriegen, Konflikten, autoritären Regierungen, in der fast nur noch Wut und Empörung herrschen und in der wir ein Business-Modell bei den Plattformen haben, das über Wut und Empörung funktioniert, werden die Inhalte so generiert und gesteuert, dass das Vorgehen gegen Frauen, die Diskreditierung von Frauen, zum eigenen Business-Modell wird.
Was treibt Frauen an, trotzdem tätig und sichtbar zu werden?
In jedem Fall natürlich, dass man die eigene Wirksamkeit spürt. Dass das, wofür ich mich einsetze, auf einmal eine Plattform hat, gehört wird von vielen anderen und ich damit Wandel erzeugen kann. Das ist ein großes Privileg, wenn das möglich ist, wenn es eine Verbesserung für die Gesellschaft erzielt.
Wie können wir uns wappnen?
Am allerwichtigsten: sich mit anderen unterstützenden Frauen zusammentun. Wir Frauen haben alle tolle bestärkende WhatsApp- und Signal-Gruppen mit ganz vielen anderen Frauen, die man aktivieren kann. Wir müssen uns aktiv diese Schutzräume schaffen.
Das heißt: Selbst wenn wir nicht an vorderster Front stehen, wäre es schon unser aller Aufgabe, die anderen Frauen, die diese Position einnehmen, zu stützen, eine Ally zu sein.
Auf jeden Fall! Ich werde für immer andere Frauen unterstützen – selbst wenn sie eine andere politische Haltung haben, solange sie die Leitplanken von Menschenwürde, Menschenrechten, Wohlwollen respektieren.
Wie fängt man an, öffentlich für seine Themen einzustehen?
Vielleicht seine Erlebnisse teilen: wenn man etwas im Alltag erlebt und sagt, Moment, da habe ich Nein gesagt und mich eingesetzt. Wenn man auf einer Veranstaltung war oder gesprochen hat. Wenn man Erkenntnisse teilen will. Das sind Beispiele fürs Vorbild sein. Fürs Vorangehen. Entweder selbst, als Person. Oder ich schließe mich einer Partei oder Gruppierung an, ich gehe zu einem Protest. Ich teile Fotos mit einem Protestschild, da steht dann meine Haltung drauf. Das kann ich mit der Welt teilen.
Wie lernen wir Frauen überhaupt, für unsere Meinungen einzustehen? Silencing gibt es ja nicht nur online.
Bei mir war es wirklich ein ganz explizites Training, bei dem ich mich immer wieder dazu gezwungen habe, Dinge zu tun, die sich wahnsinnig unangenehm angefühlt haben. Am Anfang meines Studiums war es ganz schlimm für mich, vor anderen zu sprechen. Ich erinnere mich fast noch körperlich an eine Konferenz, wo der damalige Außenminister Westerwelle sprach. Als man danach Fragen stellen durfte, habe ich gesehen, wie sich sofort ausschließlich Männer gemeldet haben. Und ich dachte: „Aber das ist genau mein Themengebiet, ich kenne mich aus. Ich zwinge mich jetzt und hebe meine Hand.“ Mein ganzer Körper wurde heiß, ich habe gezittert, ein Gefühl, als würde ich gleich in Ohnmacht fallen. Wirklich fürchterlich. Aber ich habe mich durchgerungen und über die Jahre immer wieder. Ich habe mir gesagt: „Das ist auch mein Platz, ich habe auch eine Berechtigung zu sprechen.“ Mir fiel auch auf, wie Politiker wie Markus Söder – ich komme aus Bayern – mit der eigenen körperlichen Größe und Präsenz in die Öffentlichkeit und in Räume hineingehen und Dinge in den Raum stellen. Und immer öfter dachte ich: „Moment mal, aber dazu wissen andere viel besser Bescheid. Auch ich habe eine gute Meinung dazu.“ Und „Okay, wenn so viele Männer etwas sagen, dass inhaltlich noch nicht mal wirklich klug ist, dann kann ich das auch.“ Sprüche wie „Carry yourself with the self-confidence of a mediocre white man“ wurden dann zu meinem Mantra.
Die Lage entwickelt sich gerade nicht in die richtige Richtung. Was gibt Ihnen trotzdem Hoffnung?
All die vielen Frauen, auf deren Schultern ich stehe, die ich persönlich kenne, deren Bücher ich lese, die ich getroffen habe, die irgendwo die erste sind, wie eine Annalena Baerbock als erste Außenministerin. Ich weiß, gegen welche Widerstände Frauen weltweit aufstehen. Ich weiß, was geschafft wurde in den letzten 200, 250 Jahren, seit die feministische Bewegung begann. Und in Momenten der eigenen Unsicherheit lese ich noch mal mehr als sonst Bücher über Vorreiterinnen, die Unglaubliches geschafft haben. In fast jedem dieser Bücher liest man auch von den Zweifeln und wie sie dann überwunden wurden. Das ist für mich ganz große Inspiration. Hoffnung erzeugt einfach Realität: Das, was in der Vergangenheit eine Hoffnung war, ist in vielen Bereichen heute Wirklichkeit. Und wenn wir uns heute einsetzen für das, auf das wir hoffen, wird das die Realität in der Zukunft sein.
Interview: Christine Ellinghaus